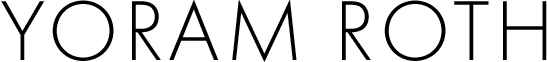In der Hauptstadt gilt das Clärchen als Gemeingut, egal, wie die Besitzverhältnisse sind. Schließlich ist es das letzte von 900 Berliner Ballhäusern der Kaiserzeit. Bis Mitte Januar wurde hier getanzt. Seither ruht der Betrieb (unabhängig von Corona), womöglich für immer, argwöhnt der Berliner. Auch wenn Yoram Roth, der neue Eigentümer, beteuert: „Ich reiße nichts ab, ich baue nichts an, ich liebe das Clärchen, wie es ist, und will nur renovieren.“ Wer glaubt das schon.
Der Mann, der ins leere Lokal bittet, will sich erklären. Dem ihm unterstellten Spekulantentum entgegentreten. Roth ist Fotograf, knapp über 50, athletisch, schlank, jovial. Er redet schnell, wechselt hin und wieder ins Englische. Ein Mann von Welt, keine Frage, der schon als Kind den Habitus alten Geldes verinnerlicht hat. Er trägt das Haar kurz, graumeliert. Ein edles Patchwork-Sakko über der Weste. Die oberen Knöpfe des weißen Hemds bleiben offen. Dazu Jeans. Das Sakko behält Roth an, die Kneipe wird gegenwärtig kaum beheizt. Oben der Spiegelsaal ist eisig, unten etwas wärmer, weil dort der Wachdienst Stellung bezogen hat. Tag und Nacht lässt Roth das Gelände per Video überwachen. „Sonst hätten wir längst Typen drinnen, die hier nichts zu suchen haben“, meint der Wächter. Regelmäßig tauchen Grüppchen auf dem Grundstück auf, meist harmlose Touristen. Ein Selfie, und weiter geht’s zur nächsten Attraktion.
Zwei Weltkriege überlebt
Clärchens Ballhaus, im Scheunenviertel an der Neuen Synagoge gelegen, ist eine Berühmtheit. Es hat zwei Weltkriege überlebt, das Dritte Reich und die DDR. In der Kaiserzeit, als Fritz Bühler und seine Frau Clara („Clärchen“) den Tanzsaal eröffneten, gingen im Spiegelsaal die Offiziere ein und aus, während unten in der Gaststube die einfachen Leute tanzten. Auch Alfred Döblin und Otto Dix verkehrten hier. Eine Fliegerbombe riss im zweiten Weltkrieg das Vorderhaus weg, die Fläche wurde Biergarten. Nach dem Krieg lud Clara zu Witwenbällen ins Haus. Sogar in DDR-Zeiten wurde hier „geschwooft“, einer der wenigen Orte, wo sich auch Westler unter das Tanzvolk mischten. Nach der Wende verkam das Haus, bis neue Pächter es vor 15 Jahren wiedererweckten mit Tanz, Steinofen-Pizza und Hausmannskost, dazu viel feiernde Prominenz, Politiker, Künstler, Schauspieler. Ende 2018 kaufte Roth das Gebäude den Wella-Erben ab und kündigte den Pächtern. Beim „letzten Schwoof“ Mitte Januar standen die Gäste Schlange, um noch einmal zu erleben, wie die alten Dielen schwingen, wenn im Spiegelsaal alles hopst und tanzt. Auch Roth wäre hingegangen, weilte aber in New York, wo seine Frau mit den drei Söhnen lebt, seit sie sich getrennt haben.
Jetzt wird das Clärchen also renoviert. Erst kommt das Lametta weg, Küche und Sanitärräume werden hergerichtet (was dringend notwendig ist). Roth entschuldigt sich für den strengen Geruch auf der Damentoilette; vermutlich eine tote Ratte, die sie noch nicht gefunden haben. Im Sommer soll das Ballhaus wieder öffnen, für anderthalb Jahre. Danach wird kernsaniert. „Ich mache alles neu, jedes Kabel, jedes Rohr, jede Kachel, und belasse doch alles beim Alten, bis hin zur abblätternden Tapete und den Rissen in den Spiegeln.“ Danach soll Leben in die Bude kommen, Roth plant Vorlesungen, Yogakurse für Schwangere, Seminare, Workshops. „Natürlich auch Tanz. Der gehört dazu, wenngleich ich kein guter Tänzer bin.“ Die Anfeindungen gegen sich versteht er nicht. Vor seiner Zeit hätte es Pläne gegeben, vorne einen Neubau mit Luxuswohnungen zu bauen, ins Ballhaus sollte gar ein Vapiano-Billig-Restaurant ziehen. „Ich plane nichts dergleichen.“ Der Voreigentümer hätte jahrelang nichts investiert. „Und die Pächter haben jeden Cent rausgezogen, um sie in ihre anderen Geschäfte zu stecken.“ Dass das Haus noch stehe, grenze an ein Wunder.

Seine Gegner wollen von Sanierung nichts wissen. In einem offenen Brief schreiben sie: Ein saniertes Clärchen sei ein „an Geschichten reicher Stumpf“, auf den sich viel Eindrucksvolles aufpfropfen ließe. Aber die Seele und die „authentische Präsenz vergangener Generationen“ ginge verloren. „Hier geht es um mehr als nur ums Ballhaus“, sagt eine der Initiatorinnen, die Galeristin Constanze Kleiner. „Es geht um Kulturpolitik im öffentlichen Raum, um Gedächtniskultur, um eine Wertediskussion.“ Es könne nicht sein, dass die Öffentlichkeit keinen Zugriff auf Einrichtungen wie das Clärchen habe. „Das ist keine Privatsache.“
So sehen das viele in Berlin, auch in der Politik. Der rot-rot-grüne Senat schreckt vor Eingriffen im Kampf gegen „Mietwucher“ und „Spekulanten“ nicht zurück. Die Mieten werden gedeckelt, über Zwangsenteignungen großer Immobilienkonzerne nachgedacht, Neuansiedlungen von Industrie so skeptisch beäugt wie die Automesse IAA, die deshalb lieber nach München zieht. „Hier schlägt einem ein kalter Antikapitalismus entgegen“, meint Roth. „Es ist fast kindisch, wie sehr es in Berlin verpönt ist, Geld zu verdienen, egal mit was. Immobilien ist ganz schlimm.“
Hausbesitzer stehen schnell unter Generalverdacht, erst recht mit dem Hintergrund Roths: Der 52-Jährige ist Jude, das allein weckt Ressentiments, zudem Erbe eines Immobilienimperiums, Sohn eines Milliardärs und Steuertricksers. Genug Stoff für Hetzer. „Ich habe mir viele Beschimpfungen anhören müssen“, sagt er, „bis hin zum Immo-Juden.“
Ein Urberliner
Dabei fühlt Roth sich vor allem als Urberliner. Mehr Berliner jedenfalls, als viele, die ihn kritisieren. Schon Roths Urgroßvater hat am Prenzlauer Berg Jugendstilbauten erworben, der Großvater dann Kinos und Bowlingbahnen. Der Vater setzte auf Bürogebäude und Hotels. Zweimal wurden sie enteignet, erst von den Nazis. Vor denen ist die Familie 1938 nach Palästina geflohen, 1954 kehrte sie nach Berlin zurück, um dort von den Sozialisten drangsaliert zu werden: „Dann enteignete uns das DDR-Regime.“ Nach der Wende erhielt die Familie den Immobilienbesitz zurück. Vor seinem Tod im Jahr 2013 war Rafael Roth, Yorams Vater, einer der reichsten Deutschen mit einem Milliardenvermögen.
Mit der Immobilientradition hat der Sohn gebrochen. „Das Geschäft hat mir keinen Spaß gemacht, das habe ich zu Hause immer offen gesagt.“ Zu seinem Vater hatte er ein enges, bisweilen angespanntes Verhältnis, schon zur Schulzeit. „Ich bin dreimal von der Schule geflogen wegen diverser Disziplinarverfahren.“ Mit 13, mit 15, mit 16. Nirgendwo hielt er es lange aus. „Ich hatte lauter Blödsinn im Kopf.“ Sex und solche Dinge. Nichts Schlimmes, betont er. In der Familie sprach man nicht viel darüber. Aber die Eltern waren enttäuscht. „Wobei ich nicht weiß, was überwog: die Enttäuschung über meine Taten oder darüber, dass ich mich erwischen ließ.“
„Noch eine Zigarette“
Wenn er an seine Kindheit denkt, fällt ihm gleich die legendäre Paris Bar ein. „Meine Eltern gingen fast jeden Abend dorthin, meine Schwester und mich nahmen sie mit.“ Er liebte es, unter dem Tisch zu hocken und die Menschen zu beobachten. „Vor allem meine Mutter, immer mit Zigarette in der Hand, so elegant, so schön. Und wenn ich fragte, Mama, wann gehen wir nach Hause, hieß es stets: Noch eine Zigarette. Ein dehnbarer Begriff! Das konnten fünf Minuten sein oder auch zwei Stunden.“
Nach der Schulzeit ging Roth nach New York, studierte zwei Jahre Fotografie, „leider ohne Abschluss“. Schuld war sein Vater, der einen Versuch startete, den Sohn doch ins väterliche Unternehmen einzubinden („Fotografie ist ein Hobby, wir aber sind Geschäftsleute.“) Im November 1989 fiel die Mauer. „Hier wird’s jetzt spannend“, prophezeite der Vater. „Du kommst nach Berlin und arbeitest für mich.“ Für Roth, damals 21, folgten Lehrjahre im Immobiliengeschäft. Nebenher hat er ein Techno-Plattenlabel gegründet. „Tags habe ich die Tasche meines Vaters getragen, nachts waren wir in den Clubs unterwegs.“
„Ich will nicht ins Risiko gehen, sondern das Geld beschützen“
Bis 1995 hielt der Junior durch. Dann zog es ihn abermals nach Amerika, diesmal an die Westküste, wo er mit einem Freund zwei Internet-Firmen gründete. Von 2007 an managte er dann für den Vater einige Traditionshotels in Holland. Hotels, erklärt Roth, leben, die brauchen ein Konzept: „Meinem Vater lag das nicht, da kam ich noch mal ins Spiel.“ Er restaurierte das Parkhotel in Amsterdam, brachte das Restaurant Momo hinein, das heute als bester Japaner Amsterdams gilt. Dann aber trennt Roth sich von den Hotels. Alle anderen Immobilien hatte der Vater schon zuvor verkauft. „Das Clärchen ist heute die einzige Immobilie, die ich besitze.“ Das Familienvermögen verwaltet sein Family Office. Sie investieren in ETFs und Private Equity rund um den Globus. Aber in keine einzelnen Aktien: „Ich will nicht ins Risiko gehen, sondern das Geld beschützen.“
Roth hat aus der Vergangenheit gelernt. Zwischen 2006 und 2008 nämlich hat der Vater sich auf gefährliches Terrain gewagt, das später im „Cum-Ex“-Skandal publik wurde. Dabei haben sich Investoren für Dividenden Kapitalertragsteuern vom Staat erstatten lassen, die sie nie bezahlt haben, vereinfacht ist das wie beim Leergut: Einer gibt die Flaschen ab, erhält einen Bon, kopiert den für seine Kumpels, alle holen sich noch mal Geld an der Kasse und teilen sich hinterher die Einnahmen.
Roth redet ungern über diesen Teil der Familiensaga. Gegen die Firma des Vaters läuft ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren. 113 Millionen Euro haben die Steuerfahnder von Roth und der HypoVereinsbank zurückgefordert – und auch erhalten. „Mein Vater wurde reingelegt. Jetzt kann er sich nicht wehren und alle rufen: Der war’s, der wusste alles.“ Im Zweifel muss der Sohn als Erbe geradestehen. Mit weiteren Nachforderungen rechnet er zwar nicht. „Aber der Schaden ist da, der Ruf unserer Familie hat gelitten.“ Und seinen Vater habe Cum-Ex ins Grab gebracht: „Er war kerngesund, als die Vorwürfe erhoben wurden. 18 Monate später war er tot. Herzversagen.“
Die Zeit nutzen für Herzensprojekte
Lieber als um die Vergangenheit kümmert Roth sich um seine Herzensprojekte. Dazu gehört neben dem Clärchen der Club „Kater Blau“, die beiden Berliner Event-Magazine Tip und Zitty, einige andere Investments. Vor allem „Fotografiska“ treibt ihn um, ein Museumskonzept für Fotografie, das wechselnde Ausstellungen zeigt. Roth ist dort Hauptinvestor. Zum Start 2010 präsentierte das Museum in Stockholm Fotos von Annie Leibovitz. Mittlerweile gibt es Dependancen in New York und Tallinn. Als nächsten Standort haben sie Berlin ins Auge gefasst. Ein Mietvertrag ist noch nicht unterzeichnet. Aber es böte sich das leerstehende Kunsthaus „Tacheles“ an, gerade um die Ecke vom Clärchen.
Das Konzept „läuft“, sagt Roth stolz. Stockholm zählt 450.000 Besucher im Jahr, das Museum ist ganzjährig geöffnet, „bis auf das Mitsommerfest, da feiern wir“. Alle drei Häuser seien profitabel. Und das ohne Subventionen, sie finanzieren sich über Restaurantbetrieb, Veranstaltungen und den Eintritt. 22 Dollar kostet der Besuch in New York. Das schreckt die Amerikaner nicht ab. Wie das Konzept in Berlin angenommen wird, da ist Roth gespannt. „Wer Eintritt nimmt, statt Subventionen einzustreichen, ist den Berlinern gleich suspekt.“
Er selbst fotografiert seit Jahren nicht mehr, nur mal wenn er durch die Stadt schlendert. Früher hat er im Studio alles akribisch arrangiert und ausgeleuchtet. Am liebsten nackte Körper, „vor allem Hände, schöne Hände begeistern mich“. Zum Beispiel die seiner Mutter, wenn sie in der Paris Bar saß und rauchte. „Diese Bewegung.“ Er lehnt sich zurück auf dem alten Holzstuhl und zieht an einer imaginären Zigarette. „Ich finde das so sexy.“ Er schaut durch den Saal. „Bald wird hier wieder gefeiert, und wenn die Erwachsenen zu Hause sind, spätnachts“, raunt er, „darf hier geraucht werden.“